Kategorie: Gedanken
-

time travellers
Vol. 13 Jetzt, da ich weiß, zieht vorbei, jene geliehene Zeit. Und ich schreibe Briefe an die Vergänglichkeit. Wie oft fiel der Regen, wusch von den Straßen jene Fußspuren, die wir hinterließen. Tropfen für Tropfen benetzte, wurde zum Ozean vor dem Glas, hinter dem wir standen. Diese Tage, an denen der Regen kam, machten uns…
-

Zwischen den Zeilen
Vol. 8 „Hier zwischen den Stühlen und den langen Korridoren des Nachmittagslichts den langen langsamen Rosenschatten vor einer weißen Wand tastend nach einem Plan einem Ort“ (Ulla Hahn, So offen die Welt) Ich sitze in Hamburg, in einem Café… meinem Lieblings-Literatur-Café. Jenes, an der Grindelallee. Ganz in der Nähe der Uni. Vor mir steht ein…
-

Anschein von Normalität
„O du runde Welt, mein Herz ist so klein wie ein Stückchen Kohle. Ist es weiträumiger als du? Ich weiß, wie begrenzt du bist! Das Auto zitterte, und ich dachte, wie eng begrenzt die Welt doch ist. Mir war ganz beklommen zumute, ich bekam kaum Luft. Heute wurden Männer im Fernsehen gezeigt, die aus ihren…
-

Politische Macht & Philosophie
Vol. 4 Und ich dachte gerade, dies sei die beste Entscheidung meines Lebens, als mein Kollege mein Büro betrat – damals, vor 20 Jahren, im September 2001. „Dein Freund lebt doch in New York, oder?“, sprach der sonst so eloquente Spanier mit diesem Tonfall. Jenem, den man nutzt, wenn man … Nun ja! Sein Teint…
-

Sandkörner im Getriebe
Vol. 3 Goethe zufolge haben wir Zeit genug, wenn wir sie nur richtig verwenden. Sind wir bloß Sandkörner im Getriebe der Zeit? Wenn dem so wäre, könnten wir doch aber nicht lieben, nicht träumen von einer besseren Welt. Sand rieselt durch die Hände. Das Leben tut es auch. Auf Sand gebaut, leben wir Tag für…
-
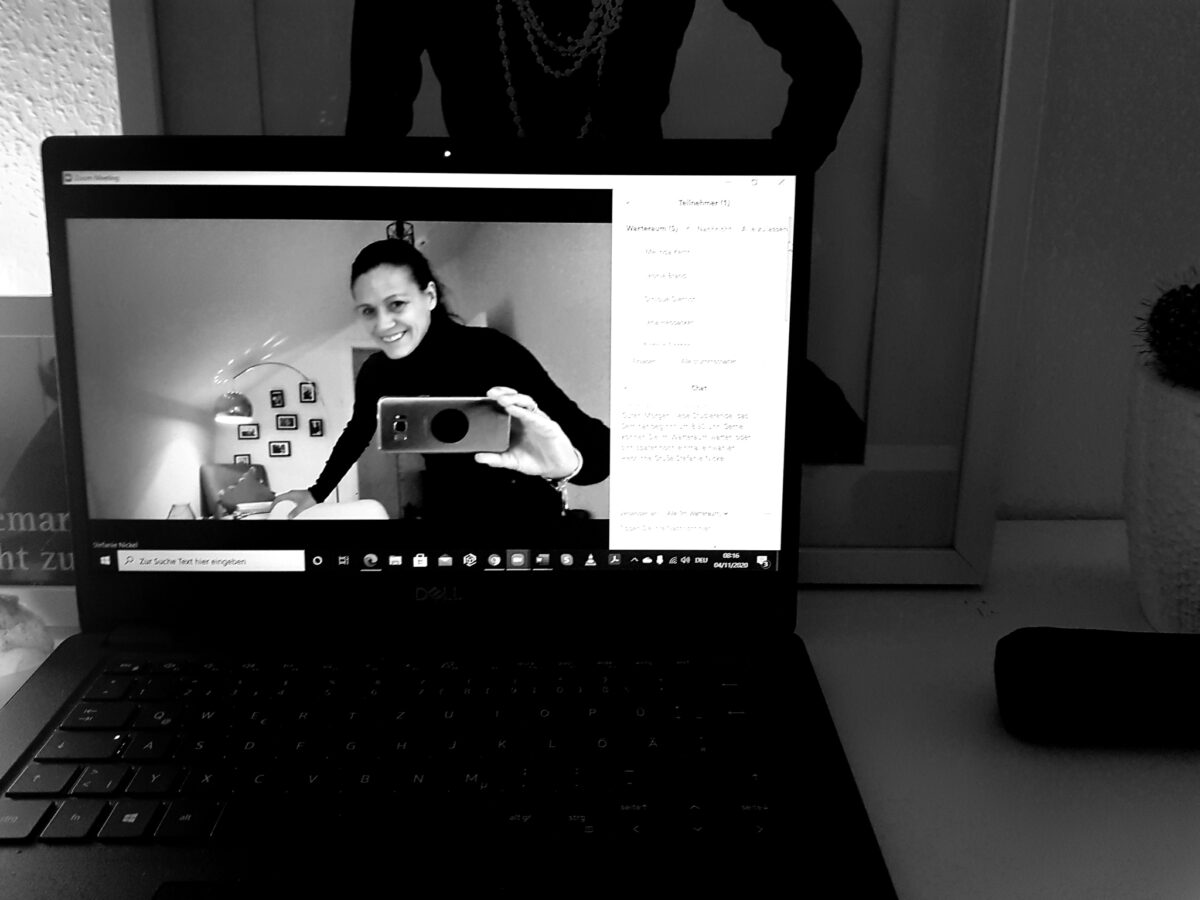
Professor goes YouTube
Vol. 2 Es ist ein kleines, rechteckiges, durchaus teilbares Ding, das da vor mir steht. Lauter kleine Quadrate öffnen sich. Namen erscheinen. Knackende, knarzende Töne. Schließlich einzelne Gesichter. Oder doch bloß schwarze Kästchen – immerhin benannt. Wer oder was sich dahinter verbirgt, bleibt ein Fragezeichen; ähnlich wie bei Watsons black box. Social escaping lässt grüßen, denke…
-

Im Fluss
Vol. 1 Seit Tagen bin ich in meiner Wohnung. Allein. Draußen ächzen die Motoren. Blech an Blech rollt vorbei: Derb, donnernd, dröhnend. Nicht unbedingt als ruhig oder gar schön zu bezeichnen, jener Ort, den ich mir für eine Weile als Bleibe ausgesucht habe. Zeit ist, wie von Einstein gelehrt, nun mal relativ. Und gerade im…